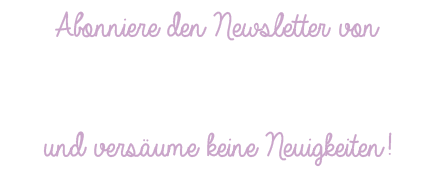Sonstiges
Teilen lernen: Wie sich soziale Kompetenz bei Kindern entwickelt
- Details
Es ist eine dieser klassischen Situationen in der Sandkiste: Ein Kind spielt vertieft mit seinem Spielzeug, ein anderes möchte genau dasselbe haben. Was dann folgt, kennen viele Eltern nur zu gut – festhalten, ziehen, weinen, schreien, vielleicht sogar hauen. Besonders angespannt wird es, wenn die anwesende Bezugsperson eingreift und fordert: „Jetzt sei doch mal lieb und teil!“

Für die meisten Eltern ist es unangenehm, wenn das eigene Kind lautstark sein Spielzeug verteidigt oder sich grob gegenüber anderen Kindern verhält. Schließlich gehört das Teilen doch zu einem guten Miteinander, das muss das Kind noch lernen!
Es ist also absolut nachvollziehbar, dass Eltern ihren Kindern diese sozialen Normen möglichst früh mitgeben möchten. Die Frage ist nur: Wie gelingt das kindgerecht und nachhaltig?
Warum kleine Kinder (noch) nicht teilen können
Zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr steht bei Kindern die Entwicklung des Ich-Gefühls im Vordergrund. Sie erleben sich erstmals bewusst als eigenständige Personen – mit eigenen Wünschen, Ideen und Bedürfnissen. Das ist ein bedeutender Schritt in ihrer Entwicklung, der mit großer Begeisterung für die eigene Selbstwirksamkeit einhergeht: „Wow, ich kann etwas bewirken!“
Gleichzeitig ist das kindliche Gehirn in dieser Phase aber noch nicht weit genug entwickelt, um sich zuverlässig in andere hineinzuversetzen. Es fehlt das Verständnis dafür, dass das andere Kind ebenfalls das Bedürfnis nach Selbstbestimmung hat – und genau deshalb auch diesen Spielzeugbagger möchte. Das Verhalten wirkt egoistisch, ist aus kindlicher Sicht aber vollkommen logisch.
Wenn Eltern dann Erwartungen stellen, die entwicklungspsychologisch noch nicht erfüllbar sind, führt das meist zu noch mehr Frust – auf beiden Seiten. Denn das kindliche Bedürfnis nach Selbstbestimmung kollidiert mit dem Wunsch der Erwachsenen nach Harmonie. Auch das ist Teil des Lernprozesses: zu erfahren, dass Selbstwirksamkeit manchmal an Grenzen stößt – einige davon lassen sich überwinden, andere nicht.
Wie Kinder wirklich teilen lernen
Warum teilen aber manche Kinder auch mit zwei Jahren scheinbar ganz selbstverständlich? Sie tun das nicht, weil sie sich in die Wünsche anderer einfühlen können, sondern weil sie Verhalten imitieren: Kinder beobachten, was andere tun – und machen es nach. Wenn teilen, helfen und trösten im Alltag selbstverständlich und unaufgeregt gelebt werden, lernen Kinder am besten.
Denn soziale Kompetenz ist kein angeborenes Verhalten, sondern ein Lernprozess, der einem natürlichen Aufbau folgt:
- Urvertrauen & Bindung (0–1 Jahre): Grundlage für Selbstwert und Vertrauen in andere
- Ich-Gefühl & Autonomie (ca. 1–2 Jahre): Entdecken der eigenen Person und Bedürfnisse
- Soziales Lernen (ab ca. 2 Jahren): Imitation von Verhalten wie Teilen, Trösten oder Mithelfen
- Empathie (ab ca. 3 Jahren): Erste Ansätze, sich in andere einzufühlen
- Regeln & Konfliktlösung (ab ca. 4 Jahren): Verständnis für Regeln und Kompromisse
Bei diesem Prozess kann eine Stufe nicht einfach übersprungen werden. Die Gehirnentwicklung vollzieht sich auch nicht schneller, wenn das Kind unter Druck ist.

Was Eltern tun können
Kinder zum Teilen zu zwingen, vermittelt ihnen nicht, warum Teilen wichtig ist – sondern eher, dass Kooperation bedeutet, die eigenen Wünsche hinten anzustellen. Viel hilfreicher ist es, dem Kind zuzugestehen, dass es bei seinem eigenen Spielzeug selbst entscheiden darf, ob es teilen möchte, oder nicht. Auch wenn das für die Eltern unangenehm ist.
Viele Konflikte lassen sich allein dadurch entschärfen, dass wir unsere Erwartungen an das tatsächliche Entwicklungsstadium des Kindes anpassen. So entstehen echte Lernchancen – und Kinder haben die Möglichkeit, in Beziehung mit anderen ihre Sozialkompetenz zu entwickeln. Nicht aus Zwang – sondern aus echtem innerem Antrieb.
Über die Autorin
 Die Autorin Elisabeth Witzani ist Elterntrainerin, Beraterin (in Ausbildung unter Supervision) und schreibt einen regelmäßigen Newsletter mit Fachwissen rund um starke Eltern-Kind-Beziehungen.
Die Autorin Elisabeth Witzani ist Elterntrainerin, Beraterin (in Ausbildung unter Supervision) und schreibt einen regelmäßigen Newsletter mit Fachwissen rund um starke Eltern-Kind-Beziehungen.
Mehr über ihre Arbeit und noch mehr Texte auf www.elisabethwitzani.at